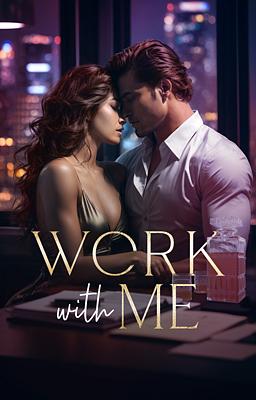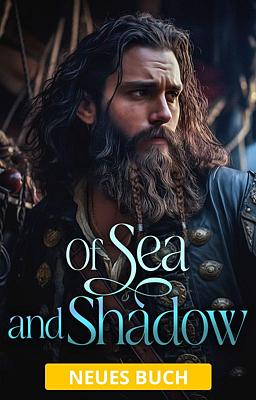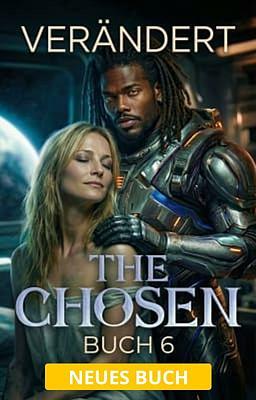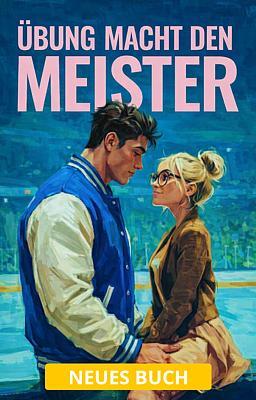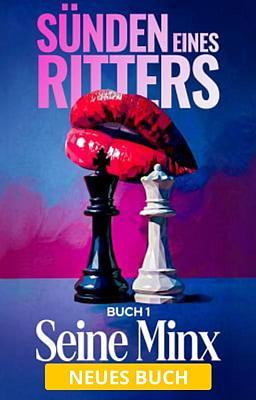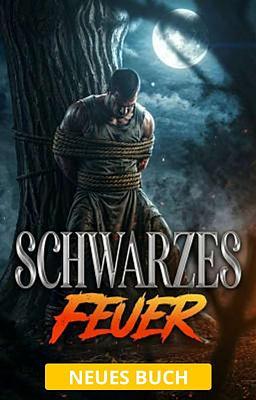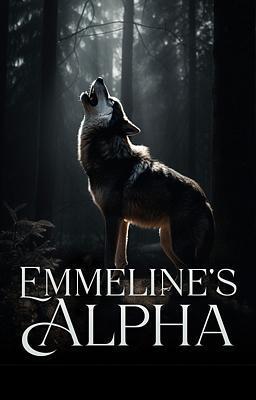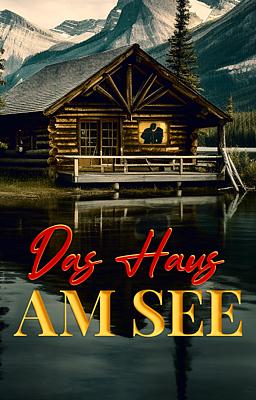Das Spiel der Krone
Penelope Tate hat niemals darum gebeten, Teil des Game of Crowns zu sein. Noch im selben Augenblick, in dem sie Asche fegt, wird sie in einen blendenden, tödlichen Wettbewerb um einen Thron geworfen, den sie nie wollte. Jeder junge Bürger muss antreten. Verbündete werden zu Feinden, Freier lächeln mit scharfen Zähnen, und uralte Mächte erwachen unter der Oberfläche.
Während Penelope sich durch Palastproben und brodelnde Geheimnisse kämpft, wird eine Wahrheit immer klarer: Wenn sie überleben will, reicht es nicht, das Spiel einfach mitzuspielen. Sie muss es überlisten. Und vielleicht ihr Herz dabei verlieren.
Kapitel 1
UNKNOWN
PENELOPE