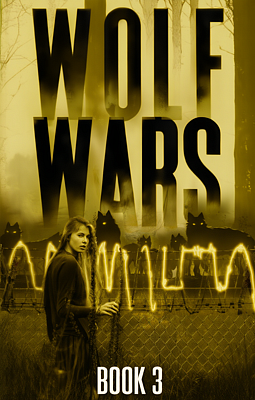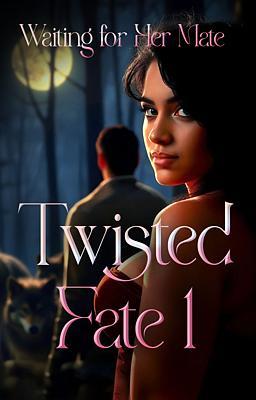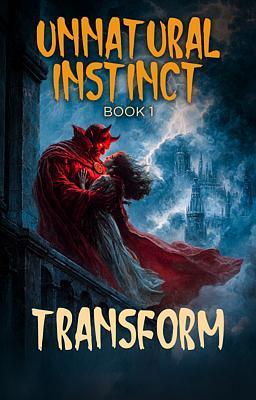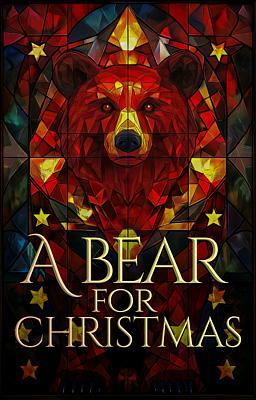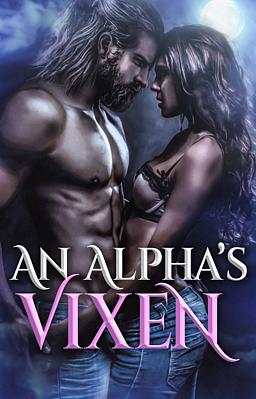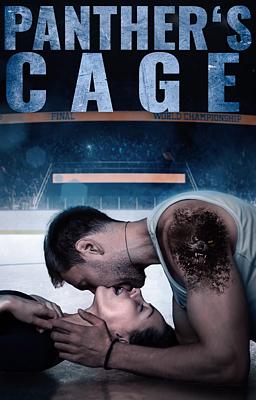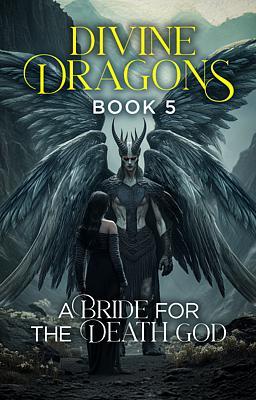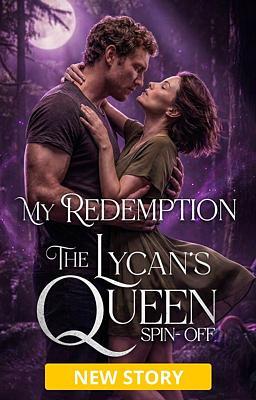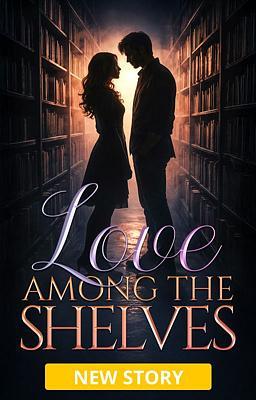Cruel Intentions Book 1: Fearing The Mafia
Maril Blake lives for joy, freedom, and chasing the good in life—until one night changes everything. After witnessing a brutal murder, she's thrown into the shadowy depths of the Mafia, straight into the hands of Severin Aresco. Cold. Ruthless. Known as the Scorpio. He doesn’t ask—he takes. And once Maril is in his grasp, he makes it clear she’s not going anywhere. She fights. He tightens his grip. But as the line between hate and heat blurs, Maril must decide if escape is still her goal… or if something darker has already claimed her.
Chapter 1
MARIL