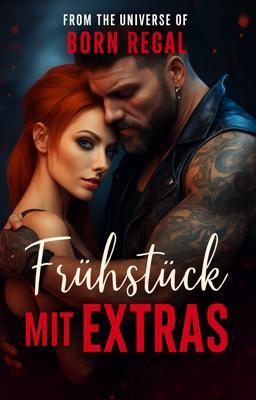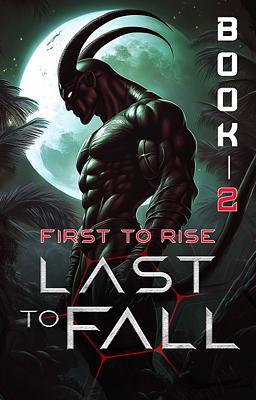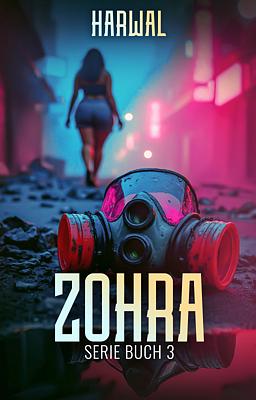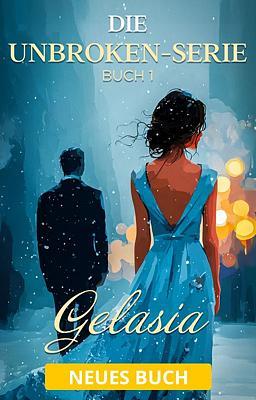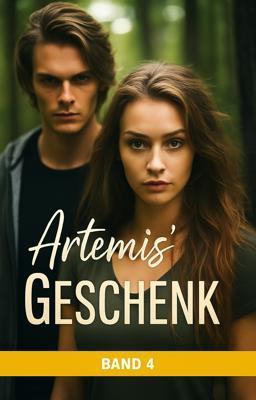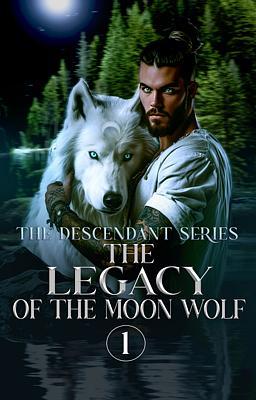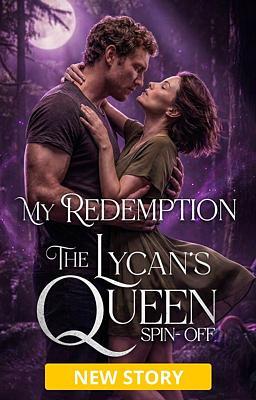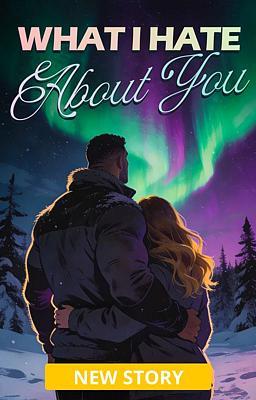Unter Vampiren 2: Die Saat, die wir säen
„Mein“, knurrte ich, meine Hände umklammerten ihre Hüften und zogen sie auf mich herab. Sie keuchte, ihre Nägel kratzten über meine Haut, ihr Atem warm an meinem Hals. Ayas kirschrote Augen fixierten meine, wild, ungezähmt, erfüllt von etwas Tieferem als Lust. Ein Versprechen. Ein Anspruch.
Er war ein Prinz. Sie war eine Dienerin. Jetzt sind sie beide etwas völlig anderes.
Einst hatte Alexander Night alles – Macht, Privilegien, eine Zukunft, die in Blut und Ruhm gemeißelt war. Dann kam die Revolution. Jetzt, seines Throns beraubt, gejagt wie ein Tier, klammert er sich an das Einzige, was noch zählt: seine verschwundene Schwester zu finden, bevor es seine Feinde tun.
Aya war einst ein Niemand. Eine Dienerin. Ein Mädchen, das einen Prinzen liebte, den sie niemals haben sollte. Die Revolution befreite sie von diesem Leben, von ihm. Aber manche Geister weigern sich, begraben zu bleiben, und als das Schicksal sie erneut in Alexanders Weg führt, trifft sie eine Entscheidung, die sie nicht treffen sollte – sie hilft ihm.
Doch die Vergangenheit steht noch immer zwischen ihnen, scharf wie eine Klinge. Die Liebe, die sie einst teilten, hat sich in etwas Unberechenbares, Gefährliches verwandelt, durchzogen von Verrat und Sehnsucht. Die Welt will sie tot sehen, aber der wahre Kampf tobt zwischen ihnen – zwischen Groll und Verlangen, Rache und Vergebung, Ruin und Erlösung.
Und in einer Welt, in der alle ihren Tod wollen, könnte das Verlangen die gefährlichste Waffe von allen sein.
Requiem für die Verlorenen
ALEXANDER
BUCH 2: Die Saat, die wir säen