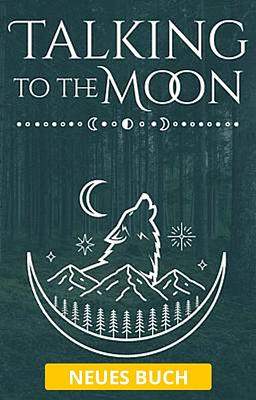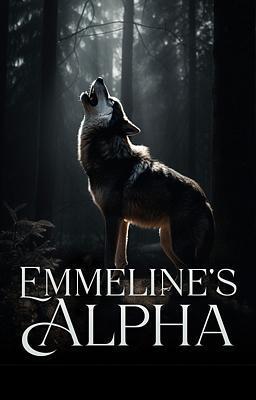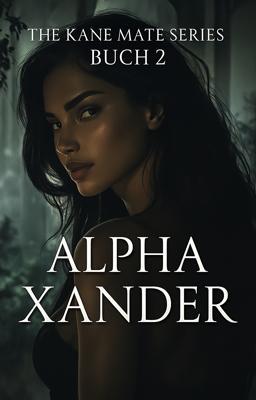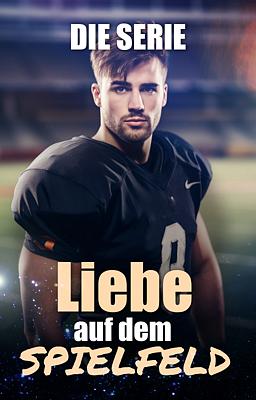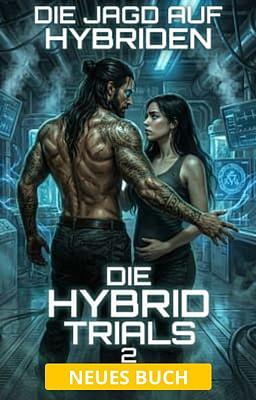Gesuchte Gefährtin des Alphas
Serenitys Leben ist von Dunkelheit erfüllt, nachdem sie ihre Mutter verloren hat und von ihrem Vater, der zu einem gewalttätigen, betrunkenen Missbraucher geworden ist, in eine neue Stadt verschleppt wurde. Sie träumt davon, der Qual zu entkommen, doch gerade als sie fliehen will, tritt ein unerwartetes Licht in ihre Welt. Ihre Reise in Richtung Freiheit nimmt eine unerwartete Wendung, als sie jemanden trifft, der ihr einen Hoffnungsschimmer bietet. Aber kann sie sich von den Ketten ihrer Vergangenheit befreien, oder wird die Dunkelheit sie ganz verschlingen?
Kapitel 1
SERENITY