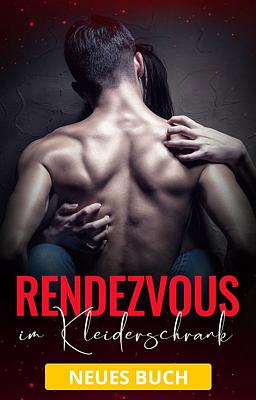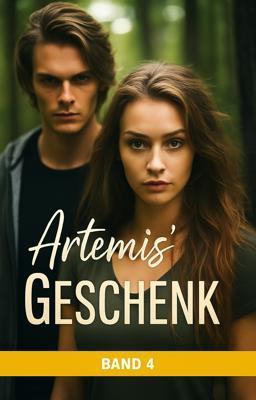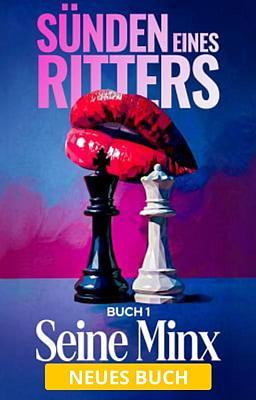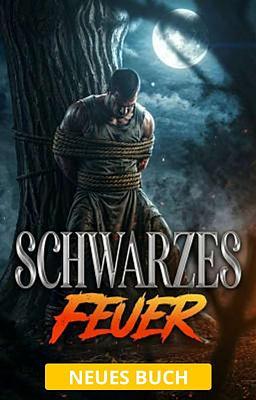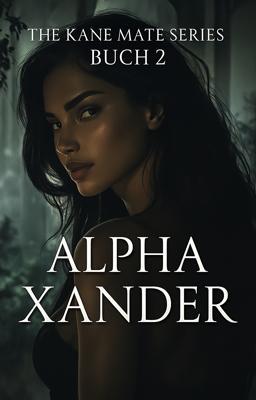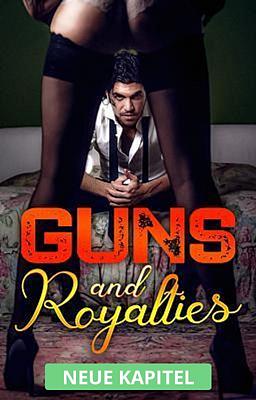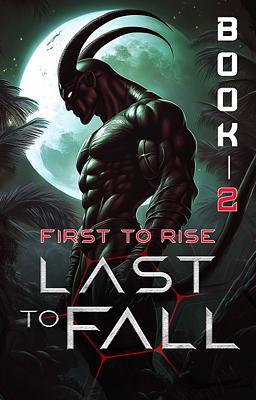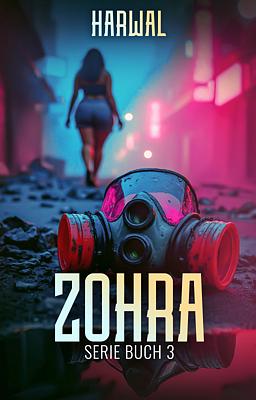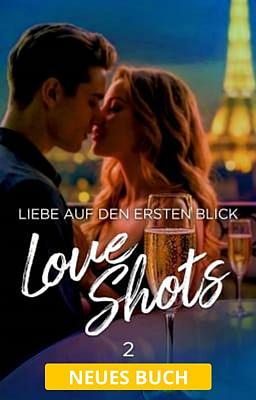Beta Xavier Costa (Deutsch)
„Was ist das?“, flüsterte Eleanor, ihre Stimme zitterte, als sie zu Xavier aufblickte, ihre Augen glänzten von unvergossenen Tränen.
„Kannst du es nicht sehen? Es ist ein Paarungsvertrag“, antwortete Xavier, sein Tonfall war kalt, während er sie ansah – die Frau, die dazu bestimmt war, sein Leben zu teilen. Eleanor fühlte eine Welle der Angst über sich hinwegspülen, als ob die Wände sich schlossen und das Gewicht des Moments verstärkten.
Eleanor hätte nie erwartet, durch einen sechsmonatigen Paarungsvertrag gebunden zu sein, schon gar nicht mit Xavier, einem Mann, den sie gerade erst kennengelernt hatte. Nach dem Verlust ihrer Mutter hatte sie die Hoffnung gehegt, dass die Liebe sie wiederfinden würde, aber nun stand sie einer erzwungenen Verbindung mit einem Mann gegenüber, dessen Vergangenheit in Geheimnissen und Schmerz gehüllt war. Der Vertrag sollte nur vorübergehend sein, doch als Eleanor und Xavier zusammengebracht wurden, wuchsen die Mauern zwischen ihnen, und die Intensität ihrer Bindung wurde auf die Probe gestellt. Würden sie lernen, einander zu lieben, oder würde das Gewicht der Geheimnisse und ungelösten Traumata sie auseinanderreißen?
Kapitel 1
ELEANOR