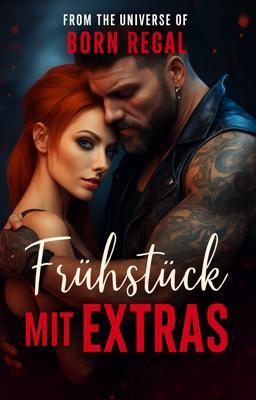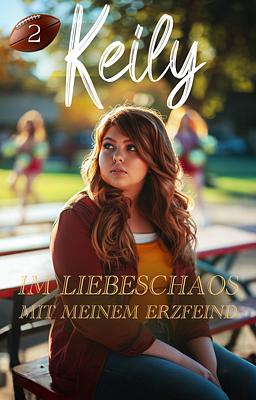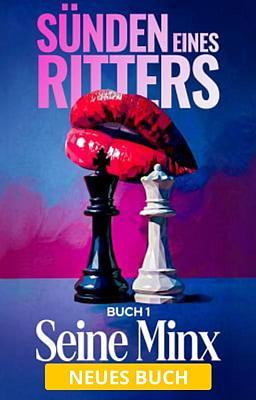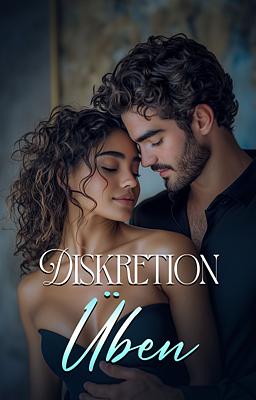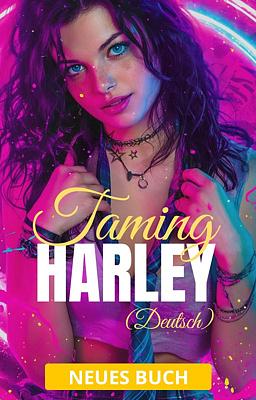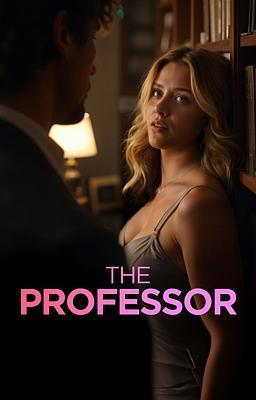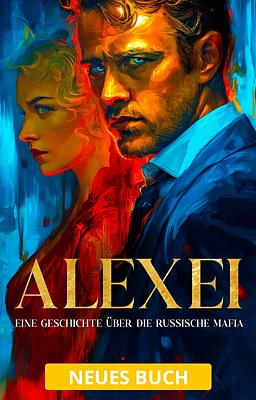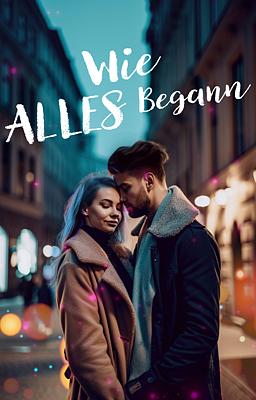Im Bett mit einem Vampir
Getrieben von Trauer steht Ravenna am Rand des Wahnsinns – und wagt in der Nacht von Allerheiligen das Undenkbare:
Sie ruft ihren toten Ehemann durch Blutmagie aus dem Grab zurück.
Doch was aus den Flammen steigt, ist nicht der Mann, den sie verloren hat –
sondern etwas Dunkleres. Hungrigeres.
Während ein fanatischer Priester immer näher kommt, sind Ravenna und ihre wiedererweckte Liebe an ein gefährliches Verlangen gebunden – eines, das Leben, Tod und Erlösung gleichermaßen herausfordert.
Zerrissen zwischen Hingabe und Verdammnis muss Ravenna sich der Wahrheit stellen:
Der Mann, den sie zurückgeholt hat, ist vielleicht nicht der, den sie liebte –
sondern das Monster, dem sie nicht widerstehen kann.
Der Käfig
Ravenna