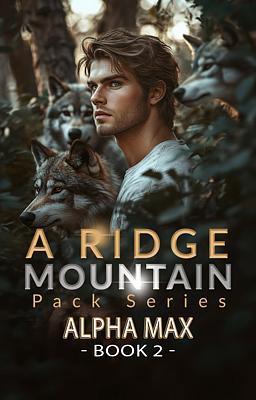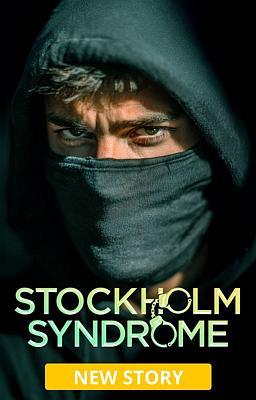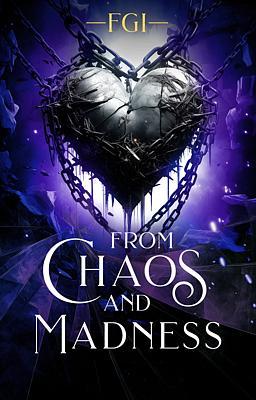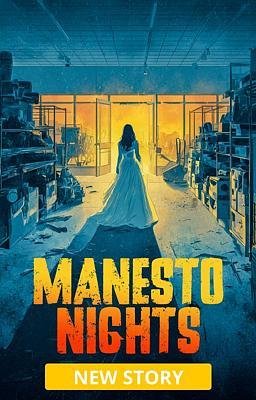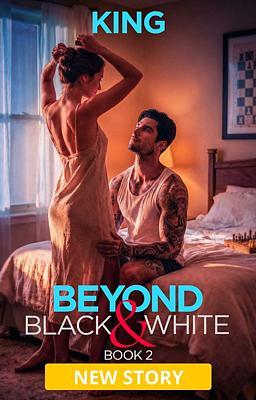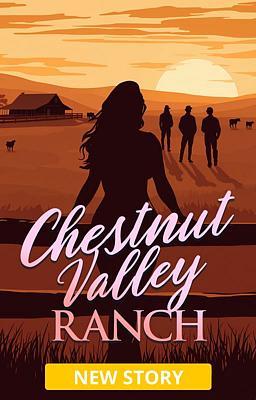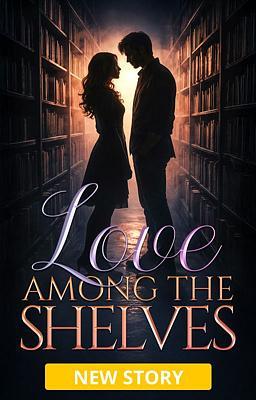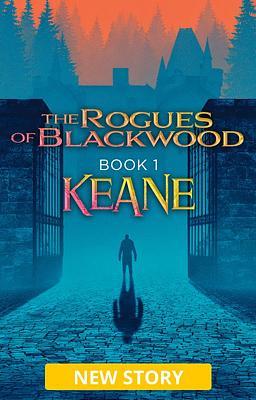Beyond Black & White Series Book 1: Bishop
Bishop is a gifted, guilt-ridden doctor who runs from duty and lands in a shadowed town. He stitches strangers by day and outruns himself by night. Quiet is his refuge—until Kallie. She is fierce, clever, and deaf; her silence steadies his storm. With her, the ache softens. But Bishop holds a secret with teeth, the kind that makes death keep its distance and turns a man into something else. When danger prowls and choices tighten, he must decide what to risk: the lie that keeps her safe, or the truth that could set them both on fire. What will Kallie see when the mask slips and the monster looks back?
Chapter 1
KALLIE